„Über die RWTH Innovation haben wir sehr schnell Zugang zu einem starken Netzwerk bekommen.“
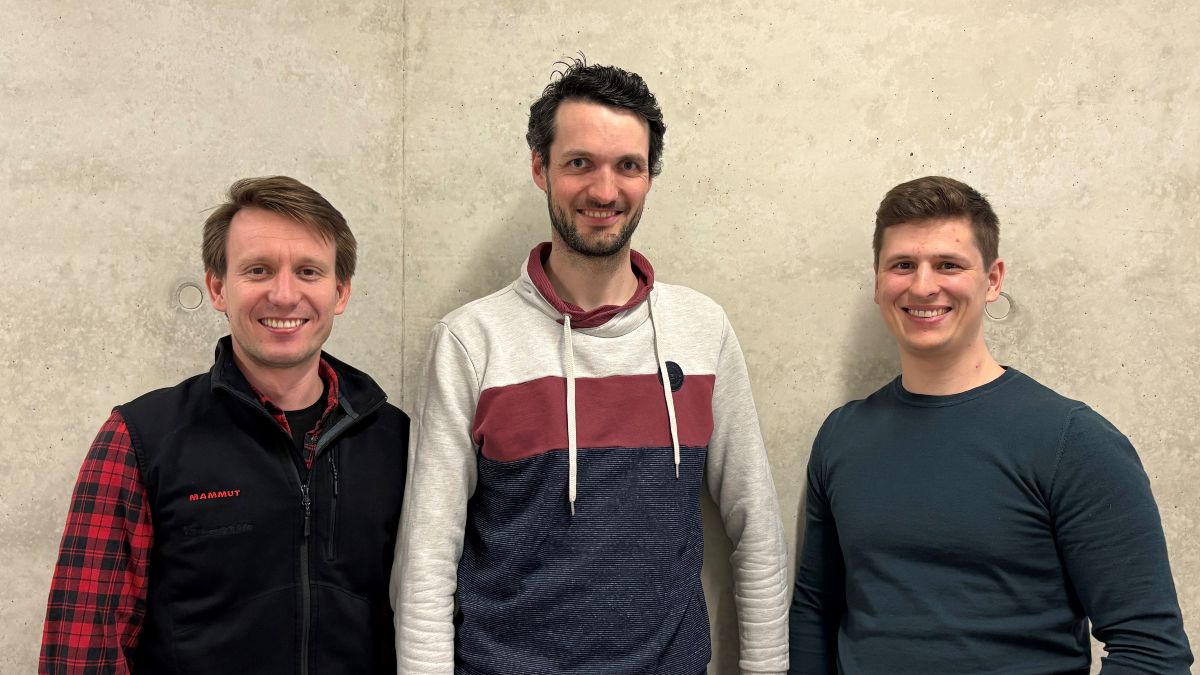
© Andreas Bremen
Die Zementindustrie gehört zu den weltweit größten Verursachern von Kohlendioxid (CO₂). Das möchte das Gründungsteam der Co-reactive GmbH ändern. Mit einem neuartigen Verfahren bindet es CO₂ in zementartige Feststoffe, die in der Bauindustrie eingesetzt werden können. Dadurch werden nicht nur Emissionen reduziert, sondern auch die Langlebigkeit und Festigkeit von Baustoffen erhöht. Im folgenden Interview berichtet Dr. Andreas Bremen darüber, wie er und seine beiden Mitgründer Orlando Kleineberg und Willi Peter bei ihren Gründungsvorbereitungen nicht nur von der RWTH Innovation und dem bundesweiten Programm EXIST-Forschungstransfer, sondern auch vom DigiHub Düsseldorf/Rheinland und von HIGH-TECH.NRW unterstützt wurden.
Herr Dr. Bremen, Sie entwickeln mit Hilfe von Kohlendioxid einen Ersatzstoff für Zement. Wie kann man sich das als Laie vorstellen?
Dr. Bremen: Zunächst muss man verstehen, vor welcher Herausforderung wir stehen: Die Industrie verursacht weltweit viel zu viele CO₂-Emissionen. Dabei gehört die Zementindustrie mit acht Prozent aller Treibhausgasemissionen zu den größten Verursachern. Emissionen entstehen dort nicht nur durch die Verbrennung fossiler Energien, sondern auch durch das sogenannte Kalzinieren: Beim Erhitzen von Kalkstein wird CO₂ freigesetzt, das wiederum in die Atmosphäre gelangt. Bisherige Lösungsansätze setzen darauf, dieses CO₂ aus den Abgasen abzuscheiden und tief unter der Erde oder unter dem Meeresboden zu speichern. Das mag ökologisch vorübergehend helfen, ist aber wirtschaftlich kaum tragfähig, weil es extrem teuer ist.
Wir gehen einen anderen Weg: Wir speichern das abgeschiedene CO₂ aus der Zementindustrie nicht unter, sondern oberhalb der Erde als Feststoff. Dafür haben wir einen speziellen Reaktor entwickelt, der das CO₂ unter Nutzung verschiedener Rohstoffe wie zum Beispiel natürliche Mineralien oder industriellen Nebenprodukten wie metallurgische Schlacken, bindet. So entstehen lager- und transportierbare Feststoffe, die – und das ist das Besondere – als zementartige Zusatzstoffe bei der Herstellung von Baumaterialien eingesetzt werden können und sogar deren Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit steigern.
Um was für Baustoffe handelt es sich?
Dr. Bremen: Unsere Zementersatzstoffe – sogenannte Supplementary Cementitious Materials (SCMs) – können in vielen Baustoffen eingesetzt werden: in Beton, in Zement und neuartigen Zementmischungen, in Trockenmörteln, Baustoffchemikalien oder in Baumaterialien für den Garten- und Landschaftsbau. Kurz gesagt: Überall dort, wo heute Zement verwendet wird, können wir einen Teil davon durch unsere SCMs ersetzen. Das bringt gleich mehrere Vorteile: Erstens wird weniger Zement benötigt. Damit sinken die CO₂-Emissionen in der Produktion. Zweitens entsteht so eine echte Alternative zu herkömmlichen Baustoffen. Und drittens wirkt unser Verfahren als CO₂-Senke: Anstatt das Kohlendioxid in der Atmosphäre zu belassen, speichern wir es dauerhaft als Feststoff und binden es damit nachhaltig außerhalb der Atmosphäre. Ein Beispiel: An eine Tonne unseres Rohmaterials können wir rund 500 Kilogramm CO₂ binden. Rechnet man Prozessenergie, Transport und Logistik mit ein, bleiben im realen Einsatz netto etwa 250 bis 300 Kilogramm gebundenes CO₂ pro Tonne.
In welchem Kontext haben Sie das Verfahren entwickelt?
Dr. Bremen: Ich habe an der RWTH Aachen zu diesem Thema promoviert. Zuvor habe ich Maschinenbau im Bachelor und Verfahrenstechnik im Master studiert. Anschließend war ich am Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik tätig und habe dort innerhalb eines größeren Forschungskonsortiums an genau dieser Fragestellung gearbeitet. Wir haben untersucht, welche Rohmaterialien sich eignen, um CO₂ dauerhaft zu binden, und wie sich diese Materialien später in zementären Systemen verarbeiten lassen. Mein Schwerpunkt lag auf der Modellierung: Ich habe einen Reaktor simuliert, ein vollständiges Prozessdesign inklusive Massen- und Energiebilanzen entwickelt und darauf aufbauend sowohl ein technoökonomisches Assessment als auch eine Lebenszyklusanalyse erstellt. Kurz gesagt: Ich habe eine holistische Bewertung erarbeitet, die Wirtschaftlichkeit, ökologische Aspekte und den gesamten Prozess vom Rohstoff bis zur Anwendung umfasst.
Ist dieses Verfahren denn innovativ? Also weltweit das erste, das so funktioniert? Oder gibt es bereits Wettbewerber?
Dr. Bremen: Es gibt durchaus Wettbewerber und auch die grundlegende Chemie ist nicht neu. Sie ist seit den 1990er-Jahren bekannt. Allerdings benötigt der konventionelle Prozess Temperaturen von bis zu 200 Grad und einen Druck von bis zu 200 bar. Unter diesen Bedingungen ist das Verfahren für die Industrie weder wirtschaftlich noch skalierbar. Unser Ansatz unterscheidet sich genau an diesem Punkt: Wir haben einen Rohrreaktor entwickelt, in dem die chemische Reaktion deutlich effizienter abläuft. Dadurch wird das Verfahren erstmals technisch und wirtschaftlich skalierbar. Das ist der eigentliche innovative Kern unserer Technologie.
Mit „uns“ meinen Sie Ihre Co-Founder?
Dr. Bremen: Ja, meinen Mitgründer, Orlando Kleineberg, kenne ich aus dem Maschinenbaustudium. Nach seinem Abschluss hat er in einem Start-up gearbeitet und dort den gesamten Weg vom Prototyp bis zum industriellen Anlagenbau mitgestaltet. Er weiß also sehr genau, wie man Technologien aus dem Labor in die Praxis bringt. Nach meiner Promotion haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir die Technologie, an der ich fünf Jahre geforscht hatte, aus dem akademischen Kontext herauslösen und technisch wie wirtschaftlich skalierbar machen können. Mit Orlandos Know-how haben wir schließlich das Rohrreaktorsystem entwickelt. Die RWTH Innovation hat uns dann bei den ersten Schritten sehr unterstützt. Wir haben zum Beispiel beide am Ideation-Programm teilgenommen und wurden dort unter anderem bei der Bewerbung für das exist Forschungstransferprogramm begleitet. In dieser Zeit haben wir uns auch immer wieder mit unserem Freund Willi Peter ausgetauscht. Er hat in St. Gallen Wirtschaftswissenschaften studiert und war lange im B2B-Bereich tätig. Irgendwann war klar: Wir brauchen ihn im Team. Also haben wir gesagt: „Willi, komm an Bord.“ Seitdem sind wir zu dritt.
Die RWTH Innovation bietet vielfältige Unterstützung für Gründungsteams an. Was fanden Sie besonders hilfreich?
Dr. Bremen: Zunächst einmal ging es für uns darum, überhaupt einen Startpunkt zu finden. Wir hatten eine Idee, ich hatte jahrelang geforscht, Orlando und Willi hatten wichtige berufliche Erfahrungen gesammelt, aber wir brauchten die richtigen Werkzeuge, um daraus ein reales Angebot zu entwickeln und ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Über die RWTH Innovation haben wir dann sehr schnell Zugang zu einem starken Netzwerk bekommen. Besonders wertvoll waren die zahlreichen Kontakte zu Venture-Capital-Fonds. Diese frühen Gespräche haben uns enorm geholfen, unser Projekt strategisch richtig aufzustellen. Während der ersten Phase von EXIST-Forschungstransfer standen uns außerdem eigene Büro- und Laborräume an der RWTH Aachen zur Verfügung. Wir konnten die Infrastruktur der Hochschule nutzen und dort den ersten Prototyp des Reaktors aufbauen.
Haben Sie auch andere Programme oder institutionelle Unterstützung in Anspruch genommen?
Dr. Bremen: Ja, wir haben zum Beispiel am Acceleratorprogramm von High-Tech.NRW teilgenommen und dort unseren ersten Award gewonnen, gefolgt vom RWTH Innovation Award und Ignition Award. Mit letzterem wurden wir nach Abschluss des achtmonatigen Ignition-Accelerator Programms des DigiHubs Düsseldorf/Rheinland ausgezeichnet. In Düsseldorf konnten wir auch ein Netzwerk aufbauen, das nach wie vor sehr wichtig für uns ist. Dazu muss man wissen, dass ein Drittel der deutschen Zementwerke und ein Großteil der Schwerindustrie in Nordrhein-Westfalen liegen. Dadurch haben wir Zugang zu starken Partnern im Anlagenbau und zu relevanten Forschungs- und Industrienetzwerken.
Der Höhepunkt in diesem Jahr war aber auf jeden Fall die Auszeichnung mit dem Publikumspreis innovation4transformation beim Innovationspreis NRW. Das hat uns noch einmal enormen Rückenwind für den Aufbau unseres Netzwerks gegeben. Für uns war das wie eine Art Gütesiegel.
Gab es denn auch Herausforderungen, die Sie bewältigen mussten?
Dr. Bremen: Die Baubranche ist extrem reglementiert. Idealerweise wird für die kommenden 100 Jahre gebaut. Entsprechend streng sind die Vorgaben dazu, welche Baustoffe eingesetzt werden dürfen und unter welchen Bedingungen. Deutschland ist hier im internationalen Vergleich besonders restriktiv. Für uns bedeutet das: Selbst, wenn ein Baustoff aus unserem neuen Material technisch mindestens genauso leistungsfähig ist wie etablierte Materialien und zusätzlich eine deutlich bessere CO₂-Bilanz hat, darf er nicht sofort verwendet werden. Er muss zunächst ein aufwendiges Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Erst dann kann er im Markt eingesetzt werden.
Wie sieht es denn aus mit potenziellen Kunden?
Dr. Bremen: Langfristig wollen wir für die Zementindustrie Anlagen aufbauen. Wir sind aber von den Kapazitäten her noch weit davon entfernt, dass wir den neuen Zementersatzstoff auf den Markt bringen können. Wir bauen jetzt gerade eine Demonstrationsanlage auf, die 1.000 Tonnen produzieren kann. Zum Vergleich: ein Zementhersteller produziert 1.000.000 Tonnen Zement pro Jahr. Bis wir so weit sind, werden wir erst einmal die Unternehmen beliefern, die unseren Ersatzstoff bei der Produktion von Baumaterialien wie Trockenmörtel, Fliesenkleber oder Putze einsetzen.
Für die Produktion selbst brauchen sie aber die Kooperation mit einem Zementwerk oder?
Dr. Bremen: Ja, genau. Wir fahren aktuell zweigleisig: zum einen bauen wir Partnerschaften mit Zementwerken auf, zum anderen mit deren Kunden, also großen Baustoffherstellern. Die sind sehr unsicher, was die Zukunft des Zementpreises betrifft. Aufgrund des Europäischen Emissionshandels für CO₂, wird sich der Zementpreis innerhalb der nächsten neun Jahre voraussichtlich fast verdoppeln. Die Industrie muss diese Entwicklung abfedern, und genau hier liegt das Interesse an unserem Verfahren: Es bietet ihnen die Möglichkeit, CO₂-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Kostenrisiken zu mindern.
Das heißt, Sie treffen auf offene Türen?
Dr. Bremen: Im Prinzip ja, aber die Baubranche ist sehr vorsichtig und benötigt etwas Zeit, um neue Lösungen zu übernehmen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass bestehende Baumaterialien extrem leistungsstark sind. Und das Thema CO₂ hat bislang eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Man muss die Industrie also dazu bringen, neue Technologien auszuprobieren und die nächsten Schritte zu gehen. Das ist ein langwieriger Prozess. Die Niederländer sind da zum Beispiel viel innovationsfreudiger. Das rührt auch daher, dass es dort keine Zementwerke gibt. Die müssen also viel effizienter mit ihren Materialien umgehen. Belgien ist stark in der Metallurgie und nutzt Schlacken, um Baustoffe herzustellen. Auch Frankreich ist deutlich innovativer in puncto Baustoffe.
Ein weiteres Problem ist der Preis. Zement ist derzeit noch sehr günstig. Jeder weiß zwar, dass er teurer wird, aber ob in drei, vier oder vielleicht acht Jahren, lässt sich nicht genau vorhersagen. Viele Akteure sind daher in Warteposition, so dass es schwierig ist, ein Unternehmen davon zu überzeugen, jetzt voranzugehen und in neue Technologien zu investieren. Dazu braucht es Partnerschaften. Wir haben zum Beispiel bereits erste Chargen im Kilogrammmaßstab unseres Materials gemeinsam mit potenziellen Kunden auf Tauglichkeit hin getestet. So stellen wir sicher, dass die von uns im nächsten Jahr vorgesehenen 1.000 Tonnen tatsächlich auch in die Produktion von Baustoffen fließen können.
Sie haben also einen Weg gefunden, sich den Markt zu eröffnen.
Dr. Bremen: Ja, aber wenn sich dann ein Branchenvertreter hinstellt und öffentlich fordert, dass der Emissionshandel abgeschafft werden soll, fragt man sich schon, ob alle die Dringlichkeit der Klimakrise wirklich verstanden haben. Der Europäische Emissionshandel existiert seit 20 Jahren. Es ist also seit zwei Jahrzehnten klar, dass sich der Preis für CO₂-Emissionen kontinuierlich erhöht. Die Industrie hatte wirklich viel Zeit, sich darauf einzustellen. Für uns besteht das große Risiko nun vor allem darin, dass die Politik jetzt nachgibt und die CO₂-Minderungsziele nach hinten verschiebt. In dem Fall können wir es dann lassen. So lange können wir uns nicht über Wasser halten. Aber ich bin nach wie vor optimistisch – und unsere Investoren auch.
Es wird also noch eine Weile dauern, bis Sie schwarze Zahlen schreiben.
Dr. Bremen: Wir gehen davon aus, dass unser Cashflow Ende der 20er Jahre positiv ist. Aktuell bauen wir die Technologie auf, um zu zeigen, dass sie funktioniert. Gleichzeitig arbeiten wir mit potenziellen Kunde daran, unser Verfahren zu skalieren und Finanzierungsoptionen zu eruieren. So eine Anlage, die etwa 300.000 Tonnen produziert, wird einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Das bekommen wir als Start-up nicht über Fremdkapital finanziert.
Wenn Sie jetzt zurückblicken – trotz aller Widrigkeiten in der Branche – gibt es schon einige Erfolgsmeldungen?
Dr. Bremen: Wir haben unser erstes Off-Take Agreement unterzeichnet. Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahr signifikante Mengen unseres Zementersatzstoffs produzieren können. Wir wollen also nicht nur Reaktoranlagen bauen, sondern das daraus entstehende Produkt auch zur Anwendung bringen.
Ein weiterer Erfolg ist, dass wir inzwischen ein Team von zehn hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut haben. Bis Mitte nächsten Jahres wollen wir auf rund 15 wachsen. Außerdem sind wir seit Kurzem nicht mehr in den Räumlichkeiten der RWTH untergebracht, sondern haben eigene Büros und Labore in Erkrath bei Düsseldorf. Es geht also Schritt für Schritt voran.
Weitere Informationen:
Stand: November 2025

Die Initiative Exzellenz Start-up Center.NRW fördert das Projekt „Building Europe’s leading integrated Tech Incubator“ an der RWTH Aachen University.


